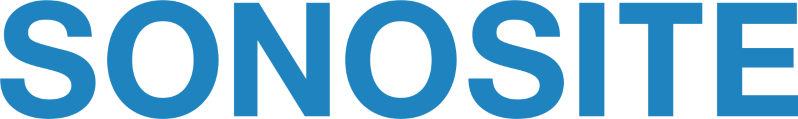Im Rahmen von Sonosites aktueller Interviewserie mit Ärzten, die die COVID-19-Pandemie aktiv bekämpfen, sprach Chief Medical Officer Diku Mandavia, M.D., mit Dr. Justin Kirk-Bayley aus dem britischen Guildford über seine Erfahrungen im Kampf gegen das Coronavirus. Sie können sich das Interview auf unserer Ressourcenseite zum Einsatz von Ultraschall bei COVID-19 ansehen.
Dr. Mandavia:
Bekanntlich befinden wir uns derzeit mitten in einer globalen Pandemie. Daher haben wir versucht, Ansichten von Ärzten aus aller Welt zu erhalten. Die Pandemie dauert immer noch an: Gegenwärtig gibt es weltweit etwa 2,7 Millionen Erkrankungen und fast 200.000 Todesfälle. Heute sprechen wir mit Dr. Justin Kirk-Bayley. Er ist Anästhesist und Facharzt für Intensivmedizin in Guildford, England. Er wird uns seine Ansichten und Erfahrungen mit COVID-19 schildern. Dr. Kirk-Bayley, willkommen und danke, dass Sie sich Zeit für uns hier bei Sonosite nehmen.
Dr. Kirk-Bayley:
Vielen Dank, dass ich hier sein darf und die Chance habe, mit Ihnen zu sprechen.
Dr. Mandavia:
Bitte erzählen Sie uns ein wenig über Ihre Arbeit und Ihren Hintergrund.
Dr. Kirk-Bayley:
Wie Sie bereits erwähnten, arbeite ich in Guildford, im Süden Englands zwischen London und der Südküste. Ich arbeite in einem sogenannten allgemeinen Bezirkskrankenhaus. Es handelt sich um ein kleines bis mittelgroßes Krankenhaus mit etwa 500 Betten und einer Intensivstation. Unsere Intensivstation umfasst 24 Betten und ist damit etwas größer als gewöhnlich. Das liegt daran, dass wir ein großes Krebszentrum sind. Im Moment behandle ich selbst COVID-19-Patienten. Aktuell befinden wir uns in Woche vier. Wir haben viel geplant und haben jetzt drei oder vier Wochen Erfahrung im Umgang mit dem Virus gesammelt. Wir sehen, wie sich unsere Patienten entwickeln, wie sich unsere Vorgehensweisen ändern, und wir warten nur darauf, dass sich auch unsere Zahlen ändern und die Patientenzahlen etwas zurückgehen.
Dr. Mandavia:
Erzählen Sie mir ein wenig darüber. Wie haben sich die Dinge im Krankenhaus verändert? Haben Sie den Höhepunkt schon erreicht oder erwarten Sie noch mehr?
Dr. Kirk-Bayley:
Wir hatten diesen deutlichen Anstieg an Patientenzahlen bereits. Unser Maximum lag bei etwa 20 Patienten auf der Intensivstation. Aktuell sind es nur noch etwa 15 oder 16 Patienten. Allerdings hat sich mein Krankenhaus inzwischen grundlegend verändert. Wenn Sie vor 12 Monaten mit mir gesprochen und mir gesagt hätten, was im Moment in meinem Krankenhaus vor sich geht, hätte ich Sie eher skeptisch angeschaut und Ihnen wahrscheinlich nicht geglaubt. Vermutlich hätte ich geglaubt, dass eine Pandemie ausbrechen würde. Allerdings hätte ich nicht geglaubt, welche Auswirkungen es auf unsere tägliche Arbeit, unsere Arbeitsweise, die medizinische Praxis, aber auch auf die allgemeinen Betriebsabläufe und die Art und Weise, wie wir uns jeden Tag in unserem Krankenhaus verhalten, haben würde. Ich hätte mir das nicht vorstellen können. Wir haben das Krankenhaus erfolgreich geräumt. Mit Ausnahme von wichtigen, lebensrettenden Operationen wurden alle Eingriffe eingestellt. Wir haben alles gestrichen, abgesehen von unmittelbar bevorstehenden Krebsoperationen. Zum Beispiel wurde die Orthopädie mit Ausnahme der Traumatologie komplett eingestellt. All die anderen Beschwerden und Probleme wurden nicht weiter behandelt. Somit sind die Patienten, die wir im Moment auf unserer Intensivstation behandeln, so gut wie alle an COVID-19 erkrankt. Zwar gab es eine Zeit, in der einige Patienten möglicherweise an COVID erkrankt gewesen sein könnten, dies liegt jedoch schon zwei Wochen zurück. Abgesehen von den Patienten, die nach einer Krebsoperation zu uns auf die Intensivstation kommen und die definitiv nicht an dem Virus erkrankt sind, sind momentan alle Patienten aufgrund einer Infektion mit diesem Virus bei uns.
Dr. Mandavia:
Das klingt nach einer ziemlich belastenden Situation. Wie Sie wissen, haben mir Ärzte aus anderen Ländern von einem erheblichen Mangel an Ressourcen berichtet. Es fehlte sowohl an PSA und Intensivbetten als auch an Beatmungsgeräten. Was können Sie uns denn dazu berichten?
Dr. Kirk-Bayley:
Wir hatten bisher das Glück, dass wir keinen akuten Mangel an PSA oder Beatmungsgeräten verzeichneten, wir wissen jedoch sehr wohl, dass die Lage sehr prekär ist. Auch wir standen kurz davor, uns damit abfinden zu müssen, auf einige dieser Dinge in Zukunft zu verzichten. Eines Morgens erfuhren wir, dass eben eine Lieferung PSA eingetroffen ist, die uns just am Tag zuvor ausgegangen war. Wir mussten unsere Anästhesiegeräte ein wenig aufstocken. Es ging dabei nur um ein oder zwei Geräte im Rahmen unseres Expansionsplans, aber inzwischen haben wir wieder unseren üblichen Bestand an Beatmungsgeräten. Aktuell müssen wir uns um Maschinen zur Hämodiafiltration und Nierenersatztherapie kümmern. Etwas, das ziemlich im Hintergrund geblieben ist und womit ich mich relativ viel beschäftigt habe, sind die Medikamente. Uns gehen so langsam unsere in der Intensivpflege gängigen Sedativa aus. Das gleiche gilt für unsere Filtrationsflüssigkeit. Wir können in Bezug auf die Filtrationsflüssigkeit nicht viel tun, außer zu entscheiden, wie wir damit umgehen wollen. Die Medikamente stellen jedoch ein ziemliches Problem dar, weil wir nie ganz sicher sind, wann wir Nachschub bekommen und woher wir ihn bekommen. Zum Glück bemerken die Mitarbeiter, die täglich vor Ort sind, die Krankenschwestern und -pfleger, die Assistenzärzte usw. nicht, was sich im Hintergrund abspielt. Sie können sich zwar nie ganz sicher sein, welche Farbe ihre PSA morgen haben wird, aber sie sind froh, dass sie sie überhaupt haben.
Dr. Mandavia:
Können Sie mir etwas über die Morbidität und Mortalität erzählen, die Sie vor Ort oder in Großbritannien allgemein beobachten?
Dr. Kirk-Bayley:
Ich kann Ihnen sagen, dass wir die Behandlung in unseren Abteilungen vor Ort etwas anders handhaben. Das ist kein großes Geheimnis. Man hat sich in Großbritannien dafür entschieden, dass wir den Behandlungsansätzen aus Italien folgen und den Schwellenwert für die Intubation der Patienten ziemlich niedrig ansetzen.
In Krankenhäusern und Ballungsgebieten, bei denen die Patientenzahlen viel früher anstiegen, wurden Patienten schon bei einem Sauerstoffbedarf von etwa 40 % intubiert. Im Anschluss erkannte man den erheblichen Ressourcenverbrauch und informierte die Mediziner darüber, was sie dagegen unternehmen sollten. Wir ehaben diese Dinge beobachtet, kamen als eine Gruppe von Intensivmedizinern zusammen und überlegten: „Werden wir das tun? Oder wollen wir sehen, was wir mit nicht-invasiver Beatmung, mit CPAP, erreichen können?” Natürlich mussten wir die Risiken einer Verbreitung des Virus durch Aerosolbildung verringern und prüfen, wie sich der Zustand der Patienten bei dieser Behandlung ändern würde. Wir konnten es nur versuchen. Wir wollten nur die am schwersten erkrankten Patienten auf die Intensivstation bringen. Auf diese Weise konnten wir uns vollkommen auf die Patienten konzentrieren, die unser Fachwissen wirklich benötigten. Normalerweise haben Sie drei bis vier Patienten mit CPAP auf der Intensivstation. Jetzt arbeiteten wir mit unseren Ärzten und Notfallmedizinern außerhalb des Krankenhauses zusammen. Mit unserer Unterstützung und unserem Fachwissen befähigten wir sie zum Einsatz von CPAP.
Sie haben das in die Tat umgesetzt, und das Ergebnis war einfach hervorragend. Für uns und unsere Aufwendungen bedeutete das, dass es bei uns Patienten gab, die nicht auf die Intensivstation gekommen sind. Sie erhielten CPAP, haben sich auf den Akutstationen erholt und sind dann nach Hause gegangen. Wir hatten natürlich auch Patienten, die auf die Intensivstation verlegt wurden. Diese waren ohne den geringsten Zweifel die am schwersten kranken Patienten, die ich und meine Kollegen jemals gesehen haben. Und wir alle haben ein paar kranke Patienten gesehen. Wir alle können uns an die besonderen Patienten erinnern, die auf die Intensivstation kommen. Aber eine Abteilung mit 15, 20 Patienten zu haben, deren Zustand zwar sehr ähnlich ist, die aber auch einzigartige Probleme haben und die wirklich gerade am Anfang ihres Lebens stehen, ist emotional, psychologisch und physisch anstrengend und erfordert wirklich jedes Quäntchen Verstand, um herauszufinden, was zu tun ist und wie man sie behandeln muss, damit ihr Zustand sich nicht verschlechtert. Bei den Patienten, die wir an ein Beatmungsgerät anschließen müssen, dauert es so lange wie in jedem anderen Land und in jedem anderen Krankenhaus, bis wir sie wieder davon losbekommen. Langsam bekommen wir das aber hin, und ich denke, die Zahl der Patienten, die nach einer Beatmung – egal ob mit oder ohne Tracheostomie – wieder gesund werden, schlägt sich leider auch in der Sterblichkeitsrate nieder. Wir haben also eine geringe Rate an Patienten, die sich wieder erholen, und eine geringe Sterblichkeitsrate.
Dr. Mandavia:
Erzählen Sie mir etwas über die Demografie der Patienten, die Sie behandeln. Nach den anfänglichen Erfahrungen, handelte es sich um eine Erkrankung, die vor allem ältere Menschen betraf. Mittlerweile wissen wir aber mehr und sehen diese Erkrankung auch bei jüngeren Patienten. Was können Sie uns dazu berichten?
Dr. Kirk-Bayley:
Der typische COVID-Patient in unserem Krankenhaus ist ein älterer Mann mit Komorbiditäten. Es betrifft eindeutig viel häufiger Männer als Frauen. Das ist ziemlich auffällig. Und wenn Menschen in ihren Fünfzigern zu uns kommen, ist das erste, was wir versuchen herauszufinden, ob sie Medikamente nehmen. Sie haben fast ausnahmslos Bluthochdruck. Wir haben auch beobachtet, dass ihr Body-Mass-Index ebenfalls leicht erhöht sein kann. Das sind also die Patienten, die unter schweren Verläufen leiden. Man sieht aber auch, wie sich die Patienten entwickeln. Je älter sie sind, je mehr Komorbiditäten sie aufweisen, desto schlechter geht es ihnen und desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie es schaffen. Aber selbst wenn sie jünger sind, dauert die Genesung lange. Es ist schon fast ein Marathon, den wir laufen müssen. Wir beobachten Dinge, die auch andere wahrnehmen, wie die unglaublich hohen Gerinnungsfaktoren. Auch wir selbst beobachten diese unglaublichen Werte und die Morbidität, die sie verursachen. Wir sehen Lungenembolien, und wenn diese in die renale Filtration gelangen, nimmt die Gerinnung im Blutkreislauf rapide zu. Bei der Messung der Blutwerte sehen wir Konzentrationen von Fibrinogen und Abbauprodukten, die wir einfach noch nie zuvor verzeichnet haben. Und wenn wir sie dann heparinisieren, stellen wir fest, dass diese Behandlung nicht anschlägt. Es ist abzuzeichnen, dass sich dieses Phänomen über alle Bereiche erstreckt. Aber es besteht kein Zweifel: Je älter man ist und je mehr Krankheiten man vor der Infektion mit dem Coronavirus hat, desto schwerer verläuft die Erkrankung und desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sie übersteht.
Dr. Mandavia:
Erzählen Sie mir von Ihren Mitarbeitern. Wie kommen Ihre Mitarbeiter damit zurecht? Sind sie betroffen und wenn ja, in welcher Weise?
Dr. Kirk-Bayley:
Nach heutigem Stand bin ich der Meinung, dass meine Mitarbeiter in ziemlich guter Verfassung sind. Wenn ich an die Anfangszeit und die schwierigen Bedingungen zurückdenke, als wir uns an vier bis sechs Stunden in PSA gewöhnen mussten, als wir unsere intensivmedizinischen Bereiche erweitert haben, weil wir diese Patientenkohorte vollständig isolieren wollten und unsere Basis so weit abbauen, dass wir alle betroffenen Patienten zusammenlegen konnten, sah der Zustand der Mitarbeiter noch ganz anders aus. In den ersten 10 Tagen verging kein einziger Tag, an dem wir nicht Mitarbeiter mit Tränen in den Augen sahen oder an dem die Mitarbeiter einen ruhigen Moment für sich selbst brauchten. Als ich gestern die Arbeit verlassen habe, war die Moral jedoch gut, weil wir eine erstaunliche Teamarbeit geleistet haben. Mitarbeiter aus anderen Abteilungen kommen zu uns. Und wir brauchen dringend diese Leute vor Ort: Pflegepersonal, Physiotherapeuten und Angehörige anderer Gesundheitsberufe, die helfen können, die Dinge am Laufen zu halten.
Tatsächlich aber wurden wir vom NHS [National Health Service] in Großbritannien wirklich geschätzt und hatten wirklich großes Glück. Im Pausenraum stapeln sich die Ostersüßigkeiten förmlich bis zur Decke und alle Kühlschränke sind voll mit Smoothies. Wir haben Kosmetika, Badezusätze, Kleidung und alles Mögliche geschenkt bekommen. Wenn man mal Zeit zum Ausruhen hat, fühlt man sich durchaus geschätzt. Man hat uns selbst gekochtes Essen gebracht. Das macht die Sache etwas leichter.
Verstehen Sie mich nicht falsch, es ist keineswegs einfach. In den letzten 10 Tagen war mein längster Aufenthalt im Pausenraum vielleicht anderthalb Stunden. Ich wollte mir eigentlich nur noch die Maske vom Gesicht reißen und verschwinden. Die Krankenschwester, mit der ich arbeitete, hatte noch mindestens ein paar Stunden vor sich. Die Arbeit ist hart, aber ich denke, wir haben uns angepasst und unsere Arbeitsweisen geändert. Wir wissen, dass wir hart arbeiten müssen, und wir müssen unsere Ruhezeiten richtig nutzen.
Und natürlich hat sich auch die Ausgangssperre bemerkbar gemacht. Wenn die Leute jetzt nach Hause gehen, dann gibt es nur sie und ihre Familien. Die Leute nutzen Videokonferenzen und Zoom und viele andere Dinge dieser Art, einfach so. Das Leben hat sich sehr verändert. Außerdem ist der Arbeitsweg im Moment wesentlich angenehmer.
Dr. Mandavia:
Ja, das ist eine zwar seltsame, aber positive Auswirkung der Pandemie. Kommen wir noch einmal auf das Personal zurück. Wie wir wissen, infizierte sich eine ganze Reihe von medizinischen Fachkräften in den Krankenhäusern. Bitte erzählen Sie mir davon. Wie ich hörte, haben Sie Ihre eigenen Erfahrungen damit gemacht.
Dr. Kirk-Bayley:
Das ist etwas, wovor wir Angst haben. Zweifellos. Es sorgt für ein gesundes Maß an Paranoia und dafür, dass die Mitarbeiter die Anweisungen in Bezug auf die PSA befolgen. Es besteht ein hohes Risiko der hermetischen Übertragung. Das Virus kann sich in den Räumen, in denen die Patienten untergebracht sind, auf den Oberflächen befinden. Und man muss wirklich vorsichtig sein, wie man seine PSA an- und auszieht. Wir hatten in unserem Krankenhaus bisher ziemliches Glück und nur einige wenige Mitarbeiter haben sich infiziert. Aber es belastet die Mitarbeiter natürlich sehr. Es ist ziemlich schwierig, jemanden zu behandeln, den man kennt und mit dem man zusammenarbeitet. Und es gibt immer diese quälenden Zweifel im Hinterkopf, ob man sich das Virus im Krankenhaus geholt hat. Einen Teil meiner Kollegen hat es auch erwischt. Man weiß nie, ob man sich im Krankenhaus, bei einem Patienten oder bei Freunden oder in der Familie angesteckt hat. Mit der Ausgangssperre ist das jetzt natürlich unwahrscheinlicher, aber man muss immer noch rausgehen, um einzukaufen usw.
Man muss jedoch wirklich sehr vorsichtig sein und sich auch noch innerhalb des Krankenhauses weiter isolieren. Wenn wir eine elektronische Visite machen, dann treffen sich die Leute in einem Raum. Wir versuchen, die Leute in den Ecken zu verteilen, damit so viel Platz wie möglich zwischen ihnen bleibt. Man will auch nicht die anderen dem Risiko einer Ansteckung aussetzen, man will nicht, dass sich die Familien der eigenen Kollegen anstecken. Wenn man einen Kollegen ansteckt, steckt der vielleicht ein älteres und möglicherweise gesundheitlich angeschlagenes Familienmitglied an.
Was micht selbst betrifft, ich habe mich gleich zu Beginn, als das Virus durch Europa fegte, angesteckt. Ich bin ziemlich sicher, dass ich mich im Urlaub infiziert habe. Es war nicht besonders angenehm. Ich habe mit anderen Kollegen gesprochen, und sie sind fit und gesund. Ich kann mich glücklich schätzen, dass ich auch fit und gesund bin. Man denkt einfach nur daran, dass es einen daran hindert, zur Arbeit zu gehen. Andere, die auch infiziert waren, haben sich ebenfalls ziemlich schuldig gefühlt. Weil sie eine Woche oder 10 Tage nicht arbeiten konnten. Es geht ihnen nicht gut, und sie wissen, dass es im Berufsalltag nicht einfacher wird. Sie möchten einfach nur wieder zur Arbeit gehen dürfen und helfen und ihren Teil leisten. Und wenn sie zurückkommen dürfen, dann sind sie auch wirklich bereit, wieder zu arbeiten.
Dr. Mandavia:
Es freut mich wirklich, dass Sie die Erkrankung mit COVID-19 gut überstanden haben. Nun sind Sie auch ein Experte auf dem Gebiet des Point-of-Care Ultraschalls. Und Sie befinden sich mitten in einer Pandemie. Sie sind auf einer Intensivstation, auf der es viele Schwerkranke mit einer höchst ungewöhnlichen Krankheit gibt. Wie setzen Sie Point-of-Care Ultraschall bei diesen Patienten ein?
Dr. Kirk-Bayley:
Der Einsatz von Point-of-Care Ultraschall hat sich mit der Zeit verändert. Wir haben uns natürlich intensiv vorbereitet und versucht, so viele Informationen wie möglich zu bekommen. Wir haben uns Webinare aus China angesehen. Wir haben uns über Trends in Italien informiert, was die italienischen Mediziner in Bezug auf den Point-of-Care Ultraschall unternommen haben. Wir haben uns mit allen Möglichkeiten der Lungendiagnostik vertraut gemacht, herausgefunden, was man mit Hilfe der Echokardiografie erkennen kann, und haben uns einfach wirklich gründlich vorbereitet. Als es dann wirklich losging und wir uns Gedanken darüber machen mussten, bei den eingelieferten Patienten Diagnosen zu stellen, begannen wir zunächst mit der Untersuchung der Lunge.
Und ich habe eine ganze Reihe von Anleitungen für Leute gegeben, ohne zu wissen, wie groß das Ganze werden würde. Ich musste Anästhesisten und Intensivmedizinern Fertigkeiten beibringen, die sie noch nicht ganz beherrschten, damit sie mögliche Beeinträchtigungen der Lunge untersuchen konnten. Dabei ging es also um Diagnostik und dann im zweiten Teil darum, sich Gedanken über die Patienten zu machen, die eventuell anders gelagert werden müssen. Es ging um Konsolidierungen und um Dinge, die man dort erkennen könnte. Und dann sind da natürlich noch die Herzmanifestationen. Ich glaube, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass, solange die Pandemie noch andauert, 2020 das Jahr der rechten Herzseite sein wird. Im Moment ist es nämlich so, dass ich bei so ziemlich jedem Patienten, der an COVID-19 erkrankt ist, B-Linien und ein alveolar-interstitielles Syndrom sehe.
Darüber hinaus entwickeln fast ausnahmslos alle Patienten, die an einem Beatmungsgerät angeschlossen sind, eine Fibrose. Das bedeutet, dass auf den Lungenscans dieser Patienten nach wie vor B-Linien zu sehen sind. Worauf wir jedoch achten – ich erinnere mich, dass ich vor Kurzem mit einem Kollegen 90 Minuten am Patientenbett verbracht habe – sind die kardiopulmonalen Wechselwirkungen. Wir versuchen einfach, ein Gleichgewicht zwischen einer optimalen Beatmung einerseits und einer nicht zu starken Beeinträchtigung des Kreislaufs andererseits zu finden. Dieser Kollege nahm also Anpassungen an einem Beatmungsgerät vor, während ich eine Ultraschalluntersuchung des Herzens durchführte und mir die Auswirkungen auf die rechte Herzseite und die Füllung der linken Herzseite genau ansah. Wenn sich der Zustand der Patienten laufend verschlechtert, schauen wir uns das an. Das ist dann natürlich ziemlich schwierig, weil sie am Beatmungsgerät angeschlossen sind. Da sieht man die Lungenzeichen in der ganzen Lunge. Zudem ist es ziemlich schwierig, brauchbare Aufnahmen des Herzens zu erhalten. Wir haben die ganze Zeit auf den Point-of-Care Ultraschall gesetzt. Lediglich der Anwendungsschwerpunkt hat sich in Richtung Herz verschoben. Ultraschall ist nach wie vor sehr nützlich, denn man kann Dinge erkennen, die man durch das bloße Betrachten von Kurven bzw. das manuelle Untersuchen der Patienten nicht erfassen kann. Letzteres ist natürlich auch immer schwieriger geworden, durch die vielen Schichten, wie Kittel und Handschuhe, die jetzt zwischen einem und dem Patienten sind. Point-of-Care Ultraschall gibt einen jedoch wie eh und je einen wertvollen Einblick in die Physiologie der Patienten.
Dr. Mandavia:
Welche Erfahrungen haben Sie bei diesen Patienten in Hinblick auf Thromboembolien gemacht? Setzen Sie dafür Ultraschall ein?
Dr. Kirk-Bayley:
Wir haben festgestellt, dass eine beträchtliche Anzahl unserer Patienten eine tiefe Venenthrombose hat. Mit Point-of-Care Ultraschall kann man das natürlich sehr leicht erkennen. Wir haben bei unseren Patienten frühzeitig eine Antikoagulation durchgeführt. Dabei meine ich die Patienten mit erheblichen Multisystemfunktionsstörungen, also Nierenversagen, Herzfunktionsstörungen und natürlich die damit einhergehende restriktive Insuffizienz. Diese Patienten weisen erhöhte bzw. hohe Fibrinogenwerte auf. Bei der Abwägung der Therapie sind wir bei diesen Patienten den Weg mit dem höheren Risiko gegangen. Wir haben bei ihnen schon ziemlich früh auf eine angemessene systemische Antikoagulation gesetzt. Aber trotz alledem gab es bei diesen Patienten – und dafür haben wir den Ultraschall eingesetzt – Anzeichen oder zumindest Warnzeichen für thromboembolische Erkrankungen.
Bei Patienten in unserem Krankenhaus, bei denen die Beatmung nicht notwendigerweise problematisch war, scheint die Lungen-Compliance bei Lungenerkrankungen infolge von COVID-19 offenbar erhalten zu bleiben. Sie benötigen also keinen wirklich hohen intrathorakalen Druck und somit ist die Belastung der rechten Herzseite ein Druck, den man bei einer erhöhten Trikuspidalinsuffizienz erwarten würde. Und doch sieht man, dass die rechte Herzkammer beeinträchtigt ist.
Bei Patienten, bei denen sich langsam ein Nierenversagen anbahnte, haben wir die Hydratation beobachtet und sichergestellt, dass wir ihr Defizit an freiem Wasser wieder ausgleichen, das sie aufgrund ihres starken Fiebers vor der Einlieferung ins Krankenhaus oder im Krankenhaus aufwiesen. Wir haben uns die Nieren angeschaut, um sicherzugehen, dass das Nierenversagen nicht eine andere, unerwartete Ursache hat, etwas anderes, das eine Hydronephrose oder etwas dergleichen auslösen könnte. Zu den neuen Werkzeugen, die wir dank Point-of-Care Ultraschall nutzen können, zählen sicherlich das Konzept der Vektoren und die Untersuchung des venösen Blutflusses in der Niere. Wir haben festgestellt, dass der Durchfluss in den Nieren nicht besonders hoch ist.
Ich benutze diese Werkzeuge immer mal wieder. Ich habe das Thema noch nicht wirklich ausführlich mit meinen Kollegen besprochen, weil nicht wirklich viele meiner Kollegen in meiner Abteilung das Scannen auf dem gleichen Niveau beherrschen. Aber ich habe dies mit guten Freunden aus ganz Großbritannien diskutiert, und sicherlich ist es schwierig, diese Dinge zu beweisen. Es handelt sich immerhin um nicht transportfähige Patienten. Wenn man sich für ein CT bzw. CT-Angiogramm oder für eine herkömmliche Untersuchung in der Radiologie entscheidet, hat man das ganze Risiko, das man bei der Verlegung eines kranken Patienten eingeht. Dazu kommt natürlich noch das Risiko der Aerosolbildung im Krankenhausumfeld. Deshalb ist eigentlich alles hilfreich, was man am Patientenbett durchführen kann. Und sicherlich gibt es Hinweise auf potenzielle Thromboembolien. Damit meine ich nicht nur das große, nicht komprimierbare Gerinnsel in der Oberschenkelvene, sondern auch Hinweise, dass an anderer Stelle im Körper eine signifikante Koagulopathie vorliegt.
Dr. Mandavia:
Das ist ein sehr umfassender Überblick über diese Patienten. Wir erhalten konsistente Rückmeldungen in Richtung eines Ganzkörper-Ultraschalls. Das ist genau das, was Sie beschreiben. Haben Sie noch ein paar abschließende Hinweise für unsere Zuschauer, sei es zum Thema Point-of-Care Ultraschall oder zu Ihren Erfahrungen mit COVID-19 im Allgemeinen?
Dr. Kirk-Bayley:
Ich glaube, man muss sich, wenn es das eigene Krankenhaus noch nicht getroffen hat, klarmachen, dass es hart wird und man nicht genug im Voraus planen kann. Es gibt nichts, was man nicht in die Wege leiten sollte, um die immensen Auswirkungen der Krankheit zu verringern, sowohl in Bezug auf die Ressourcen als auch auf sich selbst. Man muss sich also bewusst machen, dass man die Tage an denen man frei hat, zur Erholung nutzt, und darauf achten sich prinzipiell nicht zu überarbeiten. Das gilt auch für den Rest der Belegschaft. Man muss versuchen, die Work-Life-Balance hinzubekommen. Wenn einem, wenn man zur Arbeit geht, das klar ist, dann ist man auf jeden Fall gerüstet. Weil Sie werden genau im Zentrum von dem allen stehen, Sie werden unter ungünstigen Bedingungen arbeiten und Dinge tun, die Sie nicht gewohnt sind. Man muss versuchen, mit Einschränkungen fertig zu werden, an die man vorher noch nicht einmal gedacht hat. Und es wird einfach nur anstrengend sein.
Wenn Sie jedoch auf einer einigermaßen ressourcenintensiven Krankenstation arbeiten und Point-of-Care Ultraschall einsetzen, ändert sich eigentlich nicht viel. Sie werden nach wie vor die Werkzeuge benutzen, die Sie haben. Sie werden sie nur auf andere Weise nutzen. Die Fähigkeiten, die Sie im Laufe der Jahre erworben haben, sind also nicht weniger wertvoll. Sie werden lediglich bemerken, dass Sie sie jetzt für eine völlig neue Krankheit einsetzen, bei der Dinge geschehen, die man so nicht erwartet hat. Es handelt sich auch um einen langen Krankheitsprozess, und mit der Zeit werden Sie diese Fähigkeiten bei Ihren Patienten auf unterschiedliche Weise einsetzen.
Dr. Mandavia:
Das ist wirklich hilfreich. Es ist für mich äußerst faszinierend, von Ärzten auf der ganzen Welt mehr über diese Krankheit zu erfahren. Ihre Erfahrungen leisten einen wichtigen Beitrag zu unserem globalen Erfahrungsschatz in Bezug auf diese Krankheit. Vielen herzlichen Dank, dass Sie sich heute Zeit für uns genommen haben. Vielen Dank für Ihre Arbeit in Guildford. Im Namen von FUJIFILM Sonosite möchte ich auch allen Ihren Mitarbeitern danken. Damit beenden wir das Gespräch, vielen Dank noch einmal.
Dr. Kirk-Bayley:
Vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen, heute mit Ihnen zu sprechen.